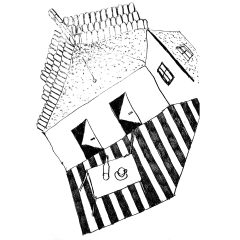Der Dienstag, der mich schon seit zwei Wochen nervös machte, begrüßte mich mit Sonne und Schreien aus den Straßen. Auf dem Balkon trank ich meinen Doppio und zündete mir eine Kippe an. Der kühle Frühlingsmorgen machte sich in der Magengegend als dumpfe Leichtigkeit bemerkbar.
Für die Sexarbeiterinnen von der Langstraße war jetzt langsam Feierabend. Mich hatte es nie gestört, dass sie ihre Arbeit in meinem Quartier verrichteten. Ich konnte mich aber nie daran gewöhnen, dass sie untereinander nie mit normaler Lautstärke sprechen konnten. An Wochenenden im Sommer war es besonders schlimm: Das Fenster offen, um nicht an einem Hitzeschlag zu sterben, zwang einen, ihren Gesprächen bis in die Früh zu lauschen.
Es gab auch den Freak der Langstraße. Er war wie ein Kind, das durch eine Schar Tauben rannte und sie verscheuchte. Jeder machte sofort einen großen Bogen um ihn.
Ich lief zum Limmatplatz, wo ich auf das Tram wartete. Diese Haltestelle war für manche wie ein Zuhause. Unzählige Obdachlose hielten sich dort auf. Zwischen gestressten Leuten mit Schlips, hippen Gästen vom Kaffee Lang und leeren Hülsen lagen sie da. Die großen Fensterscheiben des Kiosks waren mit Werbeplakaten zugeklebt. Eine davon war eingeschlagen. Man sah kaum hinein, was vermutlich Absicht war. Denn zu sehen wären nur Obdachlose, die sich ihr neun-Uhr-Bier gönnten.
Vor Monaten hatte ich mich mit einem unterhalten. Er hatte zwar das Glück zu leben und machte den Umständen entsprechend einen relativ gesunden Eindruck, doch Glück an sich war ihm fremd geworden. Er hatte vergessen, dass Glück in kleinen Mengen kommt – in schüchternen Schüben. Eine trockene Zeitung, die ihm unter seinem zerschlissenen Shirt Wärme spendete. Eine halb gerauchte Zigarette, die seine unterkühlte Lunge füllte und ihn für einen kurzen Moment leichter werden ließ.
Ich sah denselben Mann dort liegen. Ich schaute ihm in die Augen, doch er erkannte mich nicht. Ich griff in meiner Hosentasche nach ein paar Münzen und warf sie in den Kaffeebecher mit der Aufschrift „Laura“, der vor ihm stand, und stieg in die Nummer 4 ein.
Ich hatte einen Termin mit Emma, der Zwillingsschwester meiner Freundin. Seit Jahren hatte ich sie nicht gesehen. Sie arbeitete an der Grundschule Pfingstweid, wo sie in der Schulleitung tätig ist. Emma hatte mein Büro mit der Schulerweiterung beauftragt, und ich machte die erste Begehung des Bauplatzes – ein komplexes Projekt.
Doch sie war es, die mich nervös machte. Aus der Lautsprecheranlage kündigte die Frauenstimme im üblichen monotonen Ton die nächste Haltestelle an: „Technopark“.
Der Kreis 5 zeigt sich hier von einer ganz anderen Seite. In diesem Dickicht aus großen Häusern steht eine kleine Grundschule, die mittlerweile zu klein ist, um die Kids aus den luxuriösen Wohntürmen aufzunehmen. Direkt dahinter war der Zirkus Knie am Einrichten. In ein paar Tagen sollte die Manege frei sein für all die Akrobatinnen und Clowns.
Der Zuckerwatten-Tom machte hier das Geschäft seines Lebens. Toms zuckersüße Zuckerwatte – sein Stand direkt neben der Schule. Es war gerade Pause. Alle Kinder rannten umher, spielten und machten sich mit einem Zuckerschock für die nächste Lektion bereit.
Ich kenne Emma seit wir fünf Jahre alt sind und sie mir im Kindergarten einen sehr leckeren Lufttee zubereitete. Seit fast fünf Jahren bin ich mit ihrer Zwillingsschwester in einer Beziehung. Die beiden haben sich auseinandergelebt, und seit Ende der Grundschule habe ich sie nie mehr gesehen.
Als wir uns dann auf dem Schulhof sahen, wurde mir wieder klar, dass sie zwar genauso aussah wie meine Freundin, doch das große Muttermal auf der linken Wange machte den großen Unterschied. Sie war wunderschön.
Wir begrüßten uns, und gleichzeitig hörte man die Pausenglocke. Sie zuckte kurz zusammen und drückte meine Hand noch fester. Die Kinder stürmten durch den Haupteingang zurück in die Schule.
„Ich mag die Pausenglocke nicht“, sagte sie. „Ich habe dem Hausmeister schon tausendmal gesagt, er soll sie austauschen.“
„Mich erinnert sie an die Pausenglocke, als wir zusammen in der Schule waren“, erwiderte ich.
Wir saßen in der Mensa und sprachen über das Projekt. Kurze Zeit später breitete sich das Thema der Vergangenheit zwischen uns aus. Es wurde regelrecht auf dem Tisch ausgewalzt, sodass am Ende der Unterhaltung sichtbare Spuren zurückbleiben würden.
Sie erzählte mir mit erschreckendem Detaillierungsgrad, wie sie sich während der Schulzeit gefühlt hatte. Nach außen hin hatte sie es nie wirklich gezeigt. Man hätte meinen können, sie sei zufrieden, so alleine. Sie berichtete, wie sie das Alleinsein mit sich selbst versöhnt hatte, wie es sie zu einer selbstbewussten Frau gemacht hatte.
Sie erzählte auch, wie viele Typen sie schon gehabt hatte und dass keiner mehr Eier gehabt hätte als sie. Sie wirkte glücklich.
Doch in ihren Augen konnte ich einen Schleier sehen, der es nicht zuließ, tiefer in sie hineinzuschauen.
Sie fragte mich nach Marie, mit vorgespieltem Interesse.
„Stell dir vor, ich hätte dieses Muttermal nicht, dann hättest du die Qual der Wahl gehabt“, sagte sie und schmunzelte.
Marie war überaus beliebt. Sie war zwar schlechter in der Schule, aber alle mochten sie. Sie konnte alle in ihren Bann ziehen. Auf den Lorbeeren ausruhen trifft ziemlich genau auf sie zu. Marie, meine Freundin, die nichts aus sich gemacht hat.
„Hätte Emma doch dieses Muttermal nicht gehabt“, dachte ich. Dieser Gedanke überraschte mich, und ich spürte, wie meine Hände feucht wurden. Kinder sind so süß und lieb und können zugleich die bösesten Geschöpfe der Erde sein, dachte ich.
Es war still, und mein starrer Blick begann zu verschwimmen, als Emma ihre Hand auf meine legte und fragte, ob ich noch eine Frage hätte.
Ich schaute zu ihr und wusste für einen Moment nicht mehr, weshalb wir uns überhaupt getroffen hatten. Ich zog meine Hand unter ihrer hervor, stand auf, packte mein schwarzes Notizbuch, dessen Seiten unbefriedigend leer blieben, verabschiedete mich und ging Richtung Ausgang.
Kurz vor den Türen drehte ich mich noch einmal um.
„Wo sind die Toiletten?“, rief ich.
Sie zeigte in die Richtung. Mir war heiß, und ich merkte, wie sich mein Shirt unter den Achseln feucht anfühlte. Ich hielt mich am Waschbecken fest und schaute in den Spiegel.
Ich fragte mich, wie mein Zwilling wäre. Würde uns auch nur ein kleiner Makel unterscheiden?
Zu Hause angekommen sah ich Marie auf der Couch sitzen. Dass sie ein Zwilling ist, wurde mir erst jetzt wieder bewusst. Ich setzte mich neben sie. Sie hatte mich kaum wahrgenommen. Wenn sie fernsah, war sie komplett versunken in ihre Sitcoms.
Sie saß links neben mir, wie Emma heute beim Meeting. Während der ganzen Zeit war das Muttermal meinem Blick verborgen. Und wenn ich Marie jetzt so ansah, konnte man meinen, sie sei ihre Zwillingsschwester.
Ich hatte ihr nicht erzählt, dass ich Emma treffen würde.
Ich rief nach ihr, worauf sie den Kopf zu mir drehte.
Und dann hatte ich plötzlich Hoffnung. Hoffnung, ein Muttermal zu sehen.